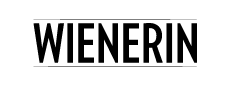Die Scheibm san Wöd
Garish holen Ina Regen, Verena Altenberger, Tanz Baby!, Anna Buchegger, Die Strottern und andere wunderbare Menschen ins Boot. Ein Tauchgang in 25 Jahre Bandgeschichte.
Garish © Reinhard Gombas
Das Album ist eine Umarmung. Und es ist eine Hand, die mal zum Spazierengehen, mal zum Tanzen entgegengestreckt wird. Als ob man von den Herren von Garish nicht ohnehin stets mit viel Tiefgang und großer Berührung verwöhnt wäre, holten sie sich zum 25. Geburtstag namhafte Verstärkung.
Und sie schufen auf diese Weise ein Album, das womöglich die Produktion oder den Willhaben-Absatz an Plattenspielern befeuern kann, denn: Das exklusive Jubiläumswerk „Hände hoch ich kann dich leiden“ wird es ab Mitte Mai „physisch“ nur auf Vinyl geben – und digital.
Wie kam es zu den bemerkenswerten Kollaborationen? Wie erging es Garish zuletzt? Wie sind die Erinnerungen an damals? Ich löcherte Tom Jarmer, bis er fast zu spät dran war, um mit seinem jüngeren Sohn einen Termin in der Schule wahrzunehmen.


Wie kam es zu diesem Projekt?
Tom Jarmer: Wir sind prinzipiell recht träge, wenn es um Jubiläen geht. Wenn es nicht eine Blitzidee gibt, wäre es für uns okay gewesen, das 25-Jährige einfach verstreichen zu lassen. Dann kam Hannes an (Tschürtz, Weggefährte, Labelchef und mehr, Anm.) und meinte: „Jungs, wie wäre es, eine Nummer mit jemandem aufzunehmen?“ – Wir dachten uns: Ein Stück Kontrollverlust tut uns gut; wir sind immer gut damit gefahren, wenn wir uns auf etwas Neues eingelassen haben.
Ina Regen war die Erste, die ihr gefragt habt. Und die Reaktion?
Sie war überrascht – aber gleich dabei. Dann tauchte die Idee mit Verena Altenberger auf. Ich hatte immer im Hinterkopf, dass es interessant wäre, mit ihr zusammenzuarbeiten.
Du kanntest sie als Schauspielerin, aber du hast sie nie singen gehört?
Nein. Als sich herausstellte, dass Ina und Verena gut befreundet sind, wurde es greifbarer, dass man bei ihr mit der Frage aufschlägt. Die Reaktion war: „Singen? Nein, danke.“ Als sie hörte, dass Ina dabei ist und anleitend fungieren wird, sagte sie zu. Ohne Gewähr. Nach dem Motto: Tun wir so lange, bis wir das Gefühl haben, da kommt etwas Gescheites dabei raus. Als die beiden dann ins Studio kamen und sich Ina ans Klavier gesetzt hat, war jede Nervosität verflogen. Es war unverkrampft und ein sehr schönes Beispiel dafür, wie unkompliziert Musikmachen miteinander sein kann. Das war eine sehr wertvolle Erfahrung nach den zähen Coronajahren. Das ganze Projekt war vom Anfang bis zum Ende wie ein Luftholen für uns alle. Als es um die Freigaben ging, hat Verena gleich im Studio gesagt: Das passt so.
Ihr hattet also „Auf den Dächern“ im Kasten, wie ging es weiter? Vor uns liegt ein Album mit zwölf Songs.
Wir haben uns eine Liste gemacht und angefangen, Leute zu fragen, die wir persönlich kannten oder ihre Arbeit, ob sie Lust hätten, Lieder von uns aufzunehmen. Julian (Schneeberger, Bandmitglied, Anm.) und ich hatten da eine Nummer, die wollte nirgends reinpassen. Das Lied war ein Exot: „Dei Wöd is a Scheibm“. Ich habe es im Dialekt geschrieben, was ich sonst nicht tue, aber es ging so leicht von der Hand und hat Spaß gemacht. Jetzt war die Platte eh schon eine bunte Zusammenstellung, da kam das gelegen, aber für mich war klar: Singen will ich das nicht. Julian hat dann Die Strottern nach einem ihrer Konzerte überfallen und – wir waren komplett! Klemens’ Stimme passt so großartig zum Stück.
Die Umsetzung war also bei jeder Nummer unterschiedlich?
Ja, auch der Anteil, wie weit wir selber mitgemischt haben. Violetta Parasini und Anna Buchegger haben sich selbst Songs ausgesucht und haben uns dann mit dem Ergebnis überrascht, das war aufregend und schön. Für das Lied „Bring mich auf Ideen“ habe ich selbst ein neues Arrangement geschrieben und dann Anna Mabo gefragt. Paul Plut ließ mich zwischendurch wissen, dass der Song „eine Mischung aus Mantra und Zauberspruch“ wird (lacht). Dann wurde aus „Draußen fischt im Eis“ ein Epos!
Wir waren eigentlich im Prozess für unser nächstes Album (geplant für 2024, Anm.). Die Platte mit den Kollaborationen war anfangs eher ein Nebenschauplatz und wurde schnell größer. Wir haben erkannt, was das für eine schöne Möglichkeit war, wieder mit Leuten zu tun zu haben und auch neue Bekanntschaften zu machen. Das war der große Bonus: den eigenen Aktionsradius zu erweitern, aus der eigenen Suppe ein bisserl rauszukommen.
Wie erlebst du das Musikerdasein aktuell?
Streaming ist omnipräsent, das ist ein an sich schlechtes Geschäft für uns. Wenn man frisch anfängt, stelle ich mir das sehr schwierig vor, weil du mit vielen Kompromissen und Abhängigkeiten, aber auch mit Chancen konfrontiert bist. Wir haben nach 25 Jahren das Glück, dass wir wie ein Wanderzirkus sind, der das Publikum mitinkludiert. Wenn wir unterwegs sind, spielen wir vor unserem Publikum. Das ist ein großer Gewinn und wir sind damit schon ein Stück unabhängiger von der ganzen Maschinerie.
Als neue Künstlerin oder Künstler ist das natürlich ein potenzielles Sprungbrett, wenn man beispielsweise in Playlists unterkommt – mit dem Abstrich: Deine Arbeit wird nicht entsprechend entlohnt. Eine Zwickmühle. Und wir haben grundsätzlich immer genau auf unsere Schmerzgrenzen diesbezüglich geachtet.
Wart ihr immer auf einem Nenner?
Wir haben Entscheidungen getroffen, nicht jeden Scheiß mitzumachen. So verunmöglichst du dir gewisse Dinge. Da ist aber nichts, was wir bereuen.

Ihr seid Familienväter. Wann war euch klar, dass ihr nicht von Garish leben wollt, dass ihr jeder extra noch eigene Wege geht oder gehen müsst?
Jetzt könnte man sagen, das Land ist proportional zu klein für das, was wir machen. Wenn du auf Tour gehst, bist du mit neun Bundesländern schnell durch. Wir haben es schließlich aus Liebhaberei betrieben. Die Langlebigkeit ist aber vielleicht genau dem geschuldet, dass es eben nie sein musste, weil wir nicht abhängig davon waren. Gleichzeitig wäre es verlogen zu sagen, wir wollten es immer nebenbei machen. Ausschließlich Musik machen zu können, ist schon auch irgendwie ein Luxus. Aber wagemutig. Max (Perner, Anm.) hat es als einziger durchgezogen: Er hat sein eigenes Studio. Julian und Kurt (Grath, Anm.) lehren, sind in verschiedene musikalische Projekte involviert und ich mache weiterhin selbstständig meine grafischen Arbeiten. – Die aufgeben? Das wäre mir auch schwer gefallen, weil ich sie gerne mag.
Im Mai präsentiert ihr das Album in der Cselley Mühle mit Künstler*innen, mit denen ihr jetzt zusammengearbeitet habt. Wer tritt mit euch auf?
Das ist noch eine Überraschung.
Bist du vor dem Auftritt nervös?
So wie früher nicht.
Wie hat sich das verändert?
Früher war der direkte Weg vom Klo auf die Bühne – und das nicht, weil ich irgendwelche Substanzen zu mir genommen habe (lacht). So grundsätzlich war ein Publikum für mich eine Zumutung in den ersten Jahren. Also vor willkürlichen Leuten zu spielen, denen es gefällt oder eben auch nicht. Es war schon oft ein Gemetzel. Keiner von uns wollte damals der Rolle wegen auf die Bühne, sondern weil wir Musik machen wollten.
Du meinst, ihr habt nicht vom Ruhm und roten Teppich geträumt?
Ich habe lieber im Studio gearbeitet. Manchmal war ein Konzert für zehn angesetzt und wir konnten erst um eins auf die Bühne, alles war verraucht, die meisten schon angesoffen. Heute erleben wir schon mehr Rücksichtnahme auf Musiker*innen und Publikum; unsere Konzerte finden in einer gesunden, optimierten Art und Weise statt.
Ich kriege das Wort Gemetzel nicht mehr aus dem Kopf.
(Lacht) Wir haben halt auch selten was ausgelassen. Wir sind nach Deutschland, ohne zu wissen, ob wer kommt, ob es eine Gage geben wird. Einmal betrug die Gage 12 Euro. Man könnte uns fragen: Ihr wart schon ziemliche Idioten, oder? – Jein. Wir waren nicht anspruchslos, aber mit unserer Musik unterwegs zu sein, hat uns genügt. Wir sind mit dem Bandbus wo hingefahren und aufgetreten, haben zusammengepackt und sind am nächsten Tag 900 Kilometer in die andere Richtung für ein Konzert. Vieles war absurd, aber es war unsere Art von Freiheit.
Wie gehst du heute auf die Bühne?
Ein gutes Maß Anspannung ist immer dabei, aber ich bin viel gelassener. Ich gehe rauf und weiß, das Ding wird passieren; unser Anteil am Konzert ist heute sehr konkret, die Art von Gewissheit gab es früher nicht. Wenn ich heute rausgehe, dann aus einem Bedürfnis heraus.
Zwischen Band und Publikum findet mittlerweile eine schöne Art der Synergie statt. Das war in den ersten Jahren nicht so, aber wir haben das auch nicht forciert. Man muss nicht unbedingt behaupten, dass Gegenstände, die auf die Bühne fliegen, unbedingt eine Art von Gruppendynamik zwischen Musiker und Publikum darstellt (lacht).
Mittlerweile sind unsere Konzerte sehr persönlich; auch wenn wir viele nicht kennen, ist es persönlich, weil die Menschen wegen uns da sind. Während der Coronazeit ist mir das sehr abgegangen: dieses Bedürfnis, auf der Bühne Musik zu machen, ausleben zu können. Darauf freue ich mich wieder.
GARISH
… bedeutet so viel wie „grell“ (englisch) und der kometenhafte Aufstieg der vor 25 Jahren als Quintett gegründeten Formation nahm klassischerweise in einem selbst betonierten Hinterhofproberaum in Mattersburg seinen Anfang. Garish sind heute Tom Jarmer, Julian Schneeberger, Kurt Grath und Max Perner; Christoph Jarmer bog zwischendurch in Richtung Solokarriere ab (sehr empfehlenswert: kristoff.at). Nach sieben Studioalben feierte Garish 2018 eine Auswahl beliebter Nummern auf einer Unplugged-Platte. Das Mitte Mai erscheinende, auf Kollaborationen mit namhaften Künstler*innen basierende Album „Hände hoch ich kann dich leiden“ erklingt live bei sechs Konzerten in Österreich. In der Cselley Mühle steigt die Sause am 17. Mai – mit Stargästen auf der Bühne.
www.garish.at
www.csello.at
Weitere Artikel zu diesem Thema
Lifestyle
5 Min.
Offene Beziehungen: Die Freiheit, neue Menschen zu entdecken
Anna verliebte sich, obwohl sie in ihrer Ehe glücklich war. Heute lebt die zweifache Mutter polyamor. Der Wermutstropfen: Ihr Mann hadert manchmal damit.
Keine Berufs- und keine Ortsbezeichnung, Anna ist nicht ihr richtiger Name. Selten begegnet man aktuell Menschen, die so strahlen und so positiv sind wie die zweifache Mutter – der Haken: Sie kann nicht ihr ganzes Glück nach außen tragen, weil ihre Lebensweise viele vor den Kopf stoßen würde, weiß die 40-Jährige. Anna hat einen Gesundheitsberuf, … Continued
5 Min.
Mehr zu Lifestyle

Abo