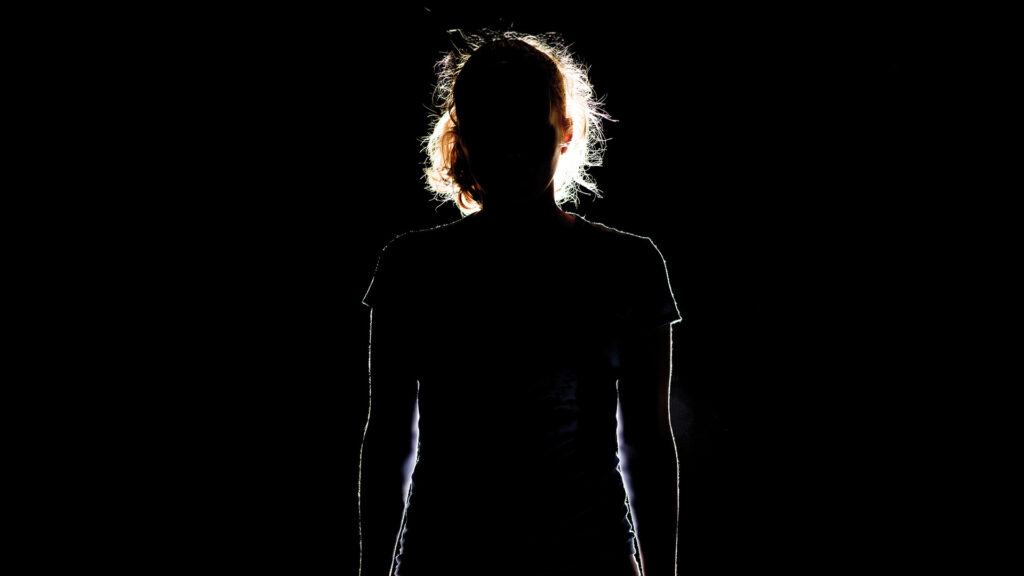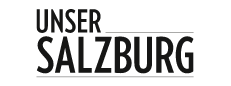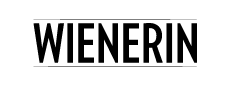Klimaschutz zwischen Aktivismus und Provokation: Was bringt uns wirklich weiter?
It's getting hot in here
© Pexels/ArtHouse Studio
Klimaaktivismus am Wendepunkt: Die „Letzte Generation“ ist Geschichte, die nächste sucht nach neuen Wegen für den Klimaschutz. Was eint und was spaltet den Kampf fürs Klima?
Es waren Bilder, die sich tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben: Aktivist:innen, die sich mit ihren Händen auf Straßen festklebten, um den Verkehr zu blockieren oder mit Öl beschmierte Kunstwerke wie das Klimt-Gemälde im Wiener Leopold Museum. Provokante Aktionen, die Aufsehen erregten und polarisierten. Nach der überraschenden Auflösung der „Letzten Generation“ in Österreich im vergangenen Sommer und dem Rückzug der britischen Klimaschutzgruppe „Just Stop Oil“ aus ihren radikalen Protestformen stellt sich die Frage: Sind solch drastische Mittel notwendig, um Aufmerksamkeit zu schaffen? Oder braucht es neue, wirkungsvollere Wege, um den dringend notwendigen Wandel voranzutreiben?
Klimawandel vor der eigenen Haustür
Während sich die Formen des Widerstands verändern, bleibt eine Krise, deren Folgen sich immer deutlicher zeigen. „Wir müssen gar nicht weit schauen, denn die Auswirkungen sehen wir direkt vor unserer Haustür“, erklärt der Wiener Klimaforscher Marc Olefs im Interview. Die Zahl der Hitzetage hat sich in Österreichs Landeshauptstädten, in denen immerhin 99 Prozent der Bevölkerung leben, verdreifacht. Starkregen-Ereignisse haben seit den 1980er-Jahren um etwa 15 Prozent zugenommen.
Auch Hagel, Gewitter und Überflutungen treten häufiger und intensiver auf. Was dabei vielen nicht bewusst ist: Einmal erreichte Gefährdungsniveaus lassen sich kaum umkehren. CO2 bleibt teils bis zu 100.000 Jahre in der Atmosphäre. Selbst wenn wir ab nächstem Jahr global klimaneutral wären, würde das Risiko nicht sofort sinken. Umso wichtiger ist es, jetzt zu handeln. Nur so können wir langfristig Spielräume zurückgewinnen, betont Olefs.

Klimapolitik, die fruchtet
Dass politisches Handeln Wirkung zeigt, belegen konkrete Zahlen. „Die Maßnahmen der letzten Regierung hatten messbare Auswirkungen auf die Emissionen. Das ist keine Theorie, sondern Realität“, sagt Olefs. Laut dem aktuellen Emissionsbericht des Umweltbundesamtes stößt Österreich heute rund 20 Prozent weniger CO2 aus als 1990. Ein wesentlicher Treiber dieses Erfolgs war die Dekarbonisierung des Heizsystems – ein direktes Ergebnis der klimapolitischen Maßnahmen der vergangenen Jahre.
Auch die Hochwasserkatastrophe im Jahr 2024 hat gezeigt, dass verbesserte Schutzmechanismen und Frühwarnsysteme Leben retten können. „Was wir tun, macht wirklich einen Unterschied“, so Olefs. Doch der Weg ist noch lang. Der Klimawandel lässt sich nicht mit symbolischen Gesten aufhalten. Er verlangt entschlossenes, langfristiges Handeln und das Engagement der gesamten Gesellschaft.
Wendepunkt im Klimaaktivismus
Mit dem Rückzug von „Just Stop Oil“ und der Auflösung der „Letzten Generation“ in Österreich beginnt ein neues Kapitel im Klimaaktivismus. Seit Anfang 2022 sorgte die Gruppe „Letzte Generation“ in Österreich mit zahlreichen Protestaktionen für Schlagzeilen. Sie unterbrachen Theateraufführungen, störten Aktionär:innen-Versammlungen, protestierten auf Flughäfen.
Im Sommer 2024 dann die überraschende Ankündigung: das Ende der Proteste in Österreich. Auch in Deutschland stellte die Gruppe Anfang desselben Jahres ihre Klebeblockaden ein. Seither haben sich Teile der Bewegung neu formiert. Aber was bleibt von den radikalen Protestformen, die mit Blockaden und Eingriffen in den Kulturbetrieb für Aufsehen sorgten? Haben diese Methoden ihr Ziel erreicht? Oder erschwerten sie vielmehr den notwendigen Dialog?
Wenn wir auf die Bürgerrechtsbewegung oder das Frauenwahlrecht blicken – dann sehen wir, dass jene, die kämpften, auch oft massiv umstritten waren.
Marc Olefs, Klimaforscher
Geschichte im Rückblick
Für Olefs lässt sich diese Frage nicht allein anhand der Wirkung der Proteste beantworten. „Es gibt einen tiefen, berechtigten Grund für diese Form des Widerstands“, betont er. „Die Sorgen, die diesen Aktionen zugrunde lagen, sind aus physikalischer Sicht völlig gerechtfertigt.“ Auch Emma Reynolds und Laila Kriechbaum, Pressesprecherinnen von Fridays for Future Austria, teilen diese Ein
schätzung: „Natürlich fragen wir uns, was wir noch tun müssen, damit endlich wirksame Maßnahmen ergriffen werden.“ Auffällig sei, dass politische Reaktionen häufig die Form des Protests kritisieren, statt sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen. „Statt zuzuhören, wurde kriminalisiert und so von der eigenen Verantwortung abgelenkt“, erklären sie.
„Wenn wir auf die großen gesellschaftlichen Kämpfe zurückblicken wie die Bürgerrechtsbewegung und das Frauenwahlrecht, dann sehen wir, dass jene, die damals kämpften, oft massiv umstritten waren. Erst Jahre oder Jahrzehnte später wurde ihr Beitrag gewürdigt. Es mag unbequem sein, dass junge Menschen sich auf die Straße setzen und Blockaden verursachen, aber vielleicht wird man in ein paar Jahrzehnten mit etwas Abstand sagen: ‚Das war nötig‘ “ erinnert der führende Klimaforscher.
Lösungsansätze, die uns voran bringen
Das Ende der radikalen Protestformen könnte auch neue Wege öffnen: pragmatischer, kooperativer, alltagsnäher. So fand im Jänner dieses Jahres erstmals die KlimaZukunft-Messe in Österreich statt, wo man auf greifbare Lösungen setzte, wie etwa Workshops, in denen Besucher:innen lernen konnten, wie nachhaltiges Leben im Alltag funktioniert. „Es geht darum, den Menschen zu zeigen, dass Klimaschutz machbar ist, auch ohne Verzicht und erhobenen Zeigefinger“, erklärt Doris Kraus, Organisatorin der KlimaZukunft-Messe. „Es sind oft die kleinen, praktischen Schritte, die den größten Unterschied machen.“

Auch Fridays for Future sieht darin Potenzial: „Es gibt nicht den einen Weg, Menschen zu mobilisieren. Manche brauchen Fakten, andere Geschichten und wieder andere konkrete Alltagstipps.“ Entscheidend sei, zu vermitteln, dass „Klimaschutz unser Leben besser, sicherer und sozialer machen kann“. Während die „Letzte Generation“ gezielt auf Provokation setzte, um maximale Aufmerksamkeit zu generieren, verfolgt Fridays for Future bewusst einen anderen Ansatz. Mit ihren Klimastreiks will die Bewegung breite gesellschaftliche Gruppen ansprechen und langfristig ein gesellschaftliches Umdenken bewirken.
Den eigenen Handabdruck vergrößern
Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, doch es gibt bereits Erfolge, die Mut machen. Die Umstellung der Heizsysteme, neue Konzepte für den Verkehr und grüne Innovationen in der Industrie zeigen, dass Wandel möglich ist. Dabei kommt es nicht nur auf technische Lösungen an, sondern auch auf gesellschaftliches Engagement und das geht nur durch eine positive Herangehensweise. „Am meisten bewirkt man als Einzelne:r, wenn man die Dringlichkeit des Klimawandels im eigenen Umfeld anspricht – in der Familie, im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz“, betont Olefs.
Auch politische Beteiligung ist wichtig: Demonstrationen, Mitarbeit in lokalen Gremien oder Briefe an Entscheidungsträger:innen können etwas bewegen. Wichtig sei außerdem, strukturelle Hindernisse klar zu benennen – etwa wenn klimafreundliches Heizen in Mehrparteienhäusern rechtlich blockiert wird. Diese Hürden müssen öffentlich gemacht werden, auch in Unternehmen, Schulen oder Vereinen. „Es geht nicht nur um den CO2-Fußabdruck, sondern auch um den persönlichen Handabdruck – also darum, aktiv an der Veränderung mitzuwirken“, so Olefs. Dieser Beitrag sei oft wirksamer, als viele denken.
Klimaschutz ist ein Marathon, kein Sprint.
Emma Reynolds und Laila Kriechbaum, Fridays for Future Austria
Fridays for Future unterstreicht: Die notwendige Veränderung ist kein abstraktes Zukunftsziel, sondern ein konkreter Auftrag an uns alle. „Die Welt rettet sich nämlich nicht durch einen perfekten Lebensstil, sondern wenn wir uns als politische Wesen verstehen – über unseren eigenen Haushalt hinaus.“ Es brauche Mut, Haltung und Zusammenarbeit über Generationen hinweg.
Die Klimakrise lässt sich nicht durch einzelne Proteste, Gesetze oder Technologien lösen. Sie verlangt ein Zusammenspiel aus allem. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Fridays for Future bringt es auf den Punkt: „Klimaschutz ist ein Marathon, kein Sprint.“ Und dennoch ist jetzt der Moment, loszulaufen – gemeinsam mit den vielen, die bereits unterwegs sind. „Wir müssen anfangen, so richtig mutig zu sein“, sagt Emma Reynolds. „Unsere kollektive Wirkungsmacht jetzt umzusetzen, steht an erster Stelle.“ Der Wandel ist möglich. Aber er beginnt nicht morgen. Er beginnt heute.
DAS KÖNNTE DICH AUCH INTERESSIEREN
- Was ist Climate Quitting?
- Nachhaltig Reisen: Tipps & Reiseziele
- Tipps für mehr Nachhaltigkeit in der Küche
MEHR ÜBER DIE REDAKTEURIN:

Als Redakteurin der WIENERIN erkundet Laura Altenhofer gerne die neuesten Hotspots der Stadt. Besonders angetan hat es ihr jedoch die vielfältige Musikszene Wiens. Ob intime Clubkonzerte oder große Festivalbühnen – man findet sie meist dort, wo die Musik spielt.
Weitere Artikel zu diesem Thema
Lifestyle
5 Min.
Offene Beziehungen: Die Freiheit, neue Menschen zu entdecken
Anna verliebte sich, obwohl sie in ihrer Ehe glücklich war. Heute lebt die zweifache Mutter polyamor. Der Wermutstropfen: Ihr Mann hadert manchmal damit.
Keine Berufs- und keine Ortsbezeichnung, Anna ist nicht ihr richtiger Name. Selten begegnet man aktuell Menschen, die so strahlen und so positiv sind wie die zweifache Mutter – der Haken: Sie kann nicht ihr ganzes Glück nach außen tragen, weil ihre Lebensweise viele vor den Kopf stoßen würde, weiß die 40-Jährige. Anna hat einen Gesundheitsberuf, … Continued
5 Min.
Mehr zu Lifestyle

Abo