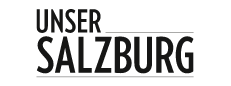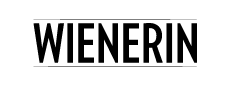Medizinethikerin Alena Buyx: Was würdest du tun?
Die Medizinethikerin Alena Buyx spricht über schwierige Entscheidungen zwischen Leben und Tod, ethische Verantwortung und KI in der Pflege.
Alena Buyx © TUM Lara Freiburger
Die Medizinethikerin Alena Buyx spricht über schwierige Entscheidungen zwischen Leben und Tod, Selbstbestimmung, den Umgang mit Emotionen und die Rolle von KI in der Pflege. Ein Gespräch über Ethik, Menschlichkeit und Verantwortung in der modernen Medizin.
Sie ist 33 Jahre jung, erfolgreiche Ingenieurin und begeisterte Sportlerin, als sie bei einer Bergtour schwer stürzt. Sie erleidet einen komplizierten Bruch des rechten Unterschenkels und mehrere innere Verletzungen. Nach zahlreichen Operationen geht es bergauf, aber das Bein will nicht. Die Heilung des Unterschenkels verläuft schlecht, ein Keim hat sich eingenistet – und es kommt zu einer Gewebsnekrose (verkürzt: absterbendes Gewebe). Die Situation spitzt sich dermaßen zu, dass eine Amputation als einzige lebensrettende Maßnahme übrig bleibt. Doch die Patientin sagt Nein.
Wenn Alena Buyx gefragt wird, welcher Fall sie besonders intensiv beschäftigt(e), nennt die Medizinethikerin oft diesen.
Was bedeutet Selbstbestimmung?
Worin besteht die Aufgabe der renommierten deutschen Professorin (sie ist übrigens mit einem Burgenländer verheiratet), deren Analysen und Standpunkte seit der Pandemie noch mehr in der Öffentlichkeit gefragt sind?
„Die Medizinethik beschäftigt sich mit dem guten und richtigen Handeln in der Medizin. Das kann sowohl die Entwicklung neuer Technologien betreffen als auch die konkrete Versorgung am Krankenbett“, beschreibt sie in ihrem fesselnden Buch „Leben & Sterben“ (S. Fischer).
Alena Buyx lehrt und forscht an der Technischen Universität München (TUM) und wird kontaktiert, wenn beispielsweise – wie zu Beginn beschrieben – ein junger Mensch beschließt, eine lebensrettende Maßnahme abzulehnen.
„Dieser Fall ist mir sehr nahegegangen“, sagt Alena Buyx im BURGENLÄNDERIN-Interview. „Das ist der Schmerzpunkt einer echten Patientenselbstbestimmung. Wenn man sorgfältig geprüft hat, dass die Patientin selbstbestimmt ist, dass sie wirklich verstanden hat, was ihre Entscheidung bedeutet, welche Konsequenzen sie hat, sie nicht unter Druck steht oder sie nicht unter einer versteckten Depression leidet, die man behandeln könnte, wenn all das geklärt ist, hat man der Selbstbestimmung zu folgen. Das kann enorm mit der ärztlichen Fürsorge in Konflikt stehen.“ – Die junge Frau starb.



Wieso wurden Sie Medizinethikerin?
Alena Buyx: Ich wollte seit meiner Schulzeit Ärztin werden, gleichzeitig habe ich mein Herz an die Philosophie verloren. Ich habe dann Medizin studiert, Philosophie und Soziologie sozusagen drumherum gewickelt – und festgestellt, dass sich die Fächer in der Medizinethik berühren.
Das gute und richtige Handeln, das Nachdenken über das Wesen der Medizin und das gute Arztsein haben mich fasziniert. Zum Ende meines Studiums kam auch noch der absolute Rockstar der Medizinethik an die Uni Münster, Bettina Schöne-Seifert übernahm das dortige Institut – und bot mir eine Stelle an. Ich wollte Neurologin werden, bin dann aber abgewandert.
Beraterin der deutschen Bundesregierung
Sie waren eine wichtige Beraterin der deutschen Bundesregierung während der Covid-Pandemie, Sie hatten den Vorsitz des Ethikrates inne. Wie hat Sie diese Zeit geprägt?
Man muss dazu sagen: Das ist ein Ehrenamt und ich habe laufend parallel Vollzeit an der Uni gearbeitet. Man überlegt sich das schon ein Jahr vorher, ob man sich vorstellen könnte, den Vorsitz zu übernehmen, weil das eine sehr intensive Ehrenarbeit ist. Gewählt wurde ich dann im Mai 2020 – direkt nach dem ersten Lockdown.
Zuvor konnten Sie also gar nicht wissen, was auf Sie zukommt?
Genau. Aber ich passte mit meiner Expertise gut in dieses Amt: Ich habe mich schon 15 Jahre vorher mit der öffentlichen Gesundheit beschäftigt und mit der österreichischen Kollegin Barbara Prainsack einen Text zu Solidarität in einer Pandemie verfasst. Dieser Vorsitz (bis 2024, Anm.) war das Inspirierendste und Wichtigste, was ich beruflich je gemacht habe – und das Schlimmste, weil es persönlich einen hohen Preis zu zahlen gab. Ich bin schwer angefeindet worden, werde das bis heute.
Ich habe den Arztberuf geliebt – und ihn verlassen, um mit diesem winzigen Orchideenfach der Medizinethik einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Mit dem kollaborativen Arbeiten im Ethikrat konnte ich gemeinsam mit Kolleg*innen einen gesellschaftlichen Impact entwickeln, für diese Gelegenheit bin ich dankbar. Wenn es auch eine getrübte Dankbarkeit ist, weil die Pandemie furchtbar war.
Vordenken für Ausnahmesituationen
Während ich Ihr Buch „Leben & Sterben“ lese, habe ich oft das Bedürfnis, den Menschen im Umfeld daraus zu erzählen, um die von Ihnen beschriebenen Fälle zu diskutieren.
Das war die Absicht! Zum Großteil beschreibe ich Fälle aus der Klinik, ich weiß also, dass das Fragen sind, die alle irgendwann im Leben beschäftigen – und wenn nicht einen selber, dann jemanden, den man liebt, den man kennt. Ich möchte mit diesem Buch ein Handwerkszeug anbieten, damit das Leben einen nicht so eiskalt erwischt. Diese Fragen überfordern einen immer, aber gewisse Dinge kann man vordenken.
Der Tod des Autors und Lehrers Niki Glattauer hat uns sehr bewegt. Wie stehen Sie dazu, dass er seinen geplanten assistierten Suizid öffentlich gemacht hat?
Menschen tun heute kund, was sie essen, wen sie hassen. Natürlich hatte Herr Glattauer das Recht kundzutun, was er möchte, wenn das nicht verfassungswidrig oder bedrohlich ist. Wir wissen, dass es beim Thema Suizid den sogenannten Werther-Effekt, also den Nachahmungseffekt gibt, darum ist es an denen, die das öffentlich machen, das verantwortlich zu tun. Dazu gibt es auch Leitlinien der journalistischen Ethik. Wenn das gut und verantwortlich passiert, weiß man aus der Forschung, dass das einen präventiven Effekt haben kann.
Es ist wichtig, gesellschaftlich zu diskutieren, was Selbstbestimmung und würdevoller Tod bedeuten, aber auch welchen Schutz Menschen brauchen, die suizidgefährdet sind. Das sind Fragen, die ein Stück weit aus der Tabuzone rausmüssen. Ich fand, dass die Artikel im Falter verantwortlich gemacht waren und auch, dass die mediale Debatte darüber in Österreich sehr gut war: differenziert, nicht reißerisch, nicht tabuisierend – und immer mit dem Hinweis auf Suizidprävention. Suizid darf keine normalisierte Form des Sterbens werden.
Pflegeroboter und KI
Thema Ihres Buches sind auch neue Technologien. Was sollen Pflegeroboter können, wo bleibt der Mensch unersetzlich?
Robotische Systeme muss man noch ein Stück weit von künstlicher Intelligenz trennen, verkörperte Technologien werden gerade noch entwickelt. Aber Roboter können schon jetzt geeignet sein, damit Menschen länger in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können; sie können helfen, Schuhe zuzubinden, etwas reichen, holen oder auf der Station beim Heben unterstützen.
Es gibt viele Pilotstudien, was sie alles noch mehr können. Den größten Benefit sehe ich bei wenig komplexen Tätigkeiten, um die Pflegenden körperlich oder bei Dokumentationstätigkeiten am Schirm zu entlasten, damit sie mehr Zeit den Patient*innen schenken können.
Die Pflege ist ein hochkomplexer Beruf, sehr nahe an vulnerablen Menschen. Der zwischenmenschliche Aspekt ist nicht ersetzbar, die Gesamtkontrolle muss immer bei der Fachperson bleiben – und auch KI soll Entfaltungsmöglichkeiten erweitern, Menschen aber nicht ersetzen.
Medizinethik & Emotionen
Seit Kurzem sind Sie eine der Moderatorinnen der fesselnden „NANO Talk“-Reihe auf 3Sat. Eine Sendung begannen Sie mit den Worten: „Mein Horror ist, dass sich mein Kind in einen Chatbot verliebt“ – Was steckt für Sie in dieser Sorge?
Eine der vielen Herausforderungen beim Thema KI-Systeme ist, dass Tech-Konzerne sie sozusagen in unsere Gesellschaft „reinknallen“ – und wir müssen mit den Folgen klarkommen. Womit nicht viele gerechnet haben, ist, dass generative KI häufig für Beziehungen genutzt wird. Das kann einige aus der Einsamkeit holen, aber es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass diese Dinge so programmiert sind, dass sie verstärken, was man ihnen sagt, damit man lange auf der Plattform bleibt, weil das Geld bringt. Das kann zum Problem werden.
Sie beschreiben einen schwierigen ethischen Konflikt um die Frühchen Tim und Mark. Die Eltern wollten nach mehr als zwei Wochen unvorstellbarem Überlebenskampf dem „Schwächeren“ weiteres Leid ersparen. Das hat auch Sie selbst als Mutter zweier Söhne sehr bewegt. Wie geht man mit Emotionen in der ethischen Analyse um?
Wir haben alle individuelle Wertüberzeugungen, gerade deswegen dürfen Emotionen – beispielsweise Abwehrgefühle – nicht unreflektiert Raum gewinnen. Sie können ein Hinweis sein, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte, aber dann muss man sich den Emotionen extern stellen und in die kognitive Analyse gehen. Emotionen dürfen keine tragende Rolle spielen, aber auch nicht ausgeblendet werden, auch weil man eine gewisse Empathie bewahren muss.

Fesselnde Beispiele aus der Realität zum Diskutieren, Nach- und Vordenken.
Alena Buyx: Leben & Sterben, Verlag S. Fischer
Weitere Artikel zu diesem Thema
Abo