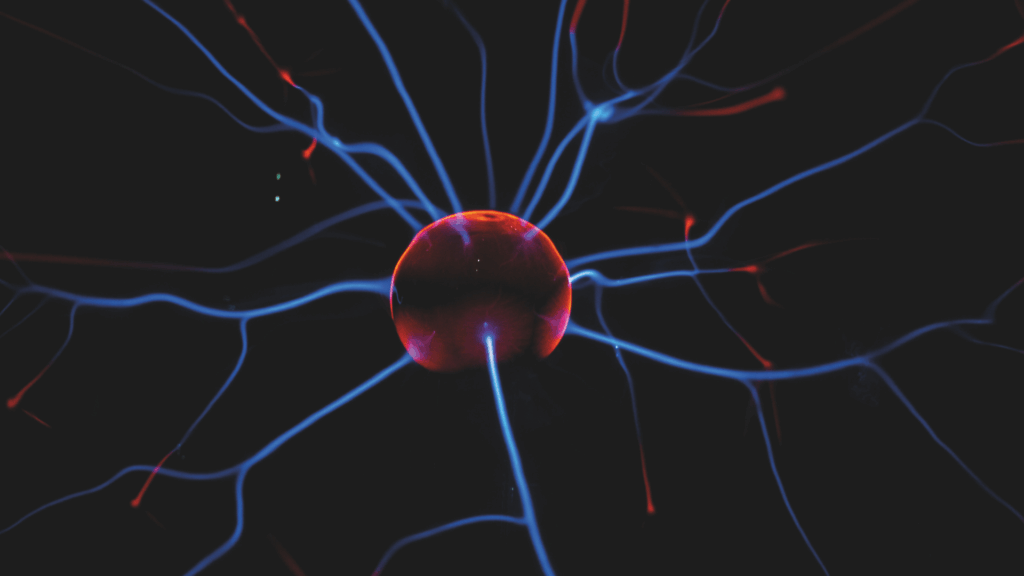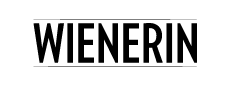Andrea Kdolsky & ein visionäres Krebszentrum
Andrea Kdolsky will im Burgenland ein Krebszentrum aufbauen, sie ist selbst Betroffene – und ortet auch abseits ihrer neuen Mission Möglichkeiten, das Gesundheitssystem zu verändern.
© Barbara Amon
Es war ein Zufallsbefund. Ihre Gynäkologin hatte sie wegen einer Zyste zur Magnetresonanzuntersuchung geschickt, heraus kam sie mit der Diagnose Darmkrebs. „HPV-induziert. Also lasst eure Kinder impfen, das gab es zu meiner Zeit noch nicht“, sagt Andrea Kdolsky. 30 Bestrahlungen brauchte sie, die sie gut vertrug, „das Glück haben nicht alle“, betont sie. Nach fordernden Monaten und der positiven Botschaft, dass der Krebs weg sei, buchte sie ein Ticket nach Griechenland.
Sie wartete am Gate, war in Gedanken schon am Meer, da bekam sie plötzlich einen sogenannten „Grand mal“, einen epileptischen Anfall, bei dem man nicht zu Boden fällt, sondern wie in einen Tunnel taucht und rundherum nichts mehr wahrnimmt. Das Nächste, woran sie sich erinnert, war, dass sie auf die Anzeigetafel blickte, wo Athen nicht mehr draufstand. „Die Maschine ist weg“, schüttelte das Bordpersonal den Kopf.
Andrea Kdolsky, ehemalige Gesundheitsministerin und seit Jahrzehnten Ärztin mit Herzblut, kontaktiert sofort ihren behandelnden Arzt, mit Verdacht auf Schlaganfall wird ein CT gemacht. „Dann stellte sich heraus, dass ich im Stirnbereich eine fast tennisballgroße Metastase habe, ich wurde sofort operiert.“ Nach der Histologie folgten die nächsten Schocknachrichten: Es war ein aggressives, schnellteilendes Karzinom, beim Ganzkörper-CT fand man weitere Metastasen.
Jeder Lebensweg mit Krebs ist anders
Mehrere Chemotherapien hat sie bereits hinter sich, die aktuelle setze ihr besonders schwer zu, sagt sie und nimmt einen Schluck von ihrer Tasse. „Tee und Suppe, mehr geht nicht. Ich hab’ eh genug Speck angesetzt“, lacht sie und wird dann wieder ernst: „Aber natürlich geht mir die Kraft aus, die Muskeln schwinden, ich merke das, wenn ich eine Dose oder eine Flasche öffnen will.“

Ich will die Dinge mit Leidenschaft tun, die ich jetzt
gerade tue.
Andrea Kdolsky, Planung & Leitung Maggie’s Centre
Andrea Kdolsky erlebt man aktuell mehr als zuletzt in der Öffentlichkeit. Es habe sich ein „Window of Opportunity“ aufgetan, sagt sie, eine Chance, wichtige Anliegen verstärkt unter die Menschen zu bringen, aber das liege nicht nur an ihrer offenen Art, mit ihrer Erkrankung umzugehen, ist sie überzeugt.
Wie geht es Ihnen?
Alle Betroffenen wissen: Krebs ist nie etwas Konstantes, das ist ein ununterbrochenes Auf und Ab, physisch und psychisch. Jetzt hoffe ich, dass die nächsten Ergebnisse besser sind, dass sich die Metastasen verringern. Momentan beschäftigen mich die Chemo-Nebenwirkungen, ich vertrage keine Medikamente gegen Übelkeit. Das fordert die Kreativität, inzwischen habe ich mein Duftflascherl mit Minze, Eucalyptus, Orange mit, daran zu riechen, hilft mir.
Sie arbeiten, wie schaffen Sie das?
Wozu Betroffene in der Lage sind, muss jede Person individuell spüren. Arbeiten ist für mich Leben, meine Aufgaben lenken mich ab. Ich arbeite an meinem Mutmacherbuch – und ich habe hier durch den Landeshauptmann einen tollen Job bekommen, wie ich ihn in 40 Jahren nicht erlebt habe.
Sie waren VP-Ministerin – spielt das eine Rolle?
Zuhause bin ich in Gablitz im Wienerwald; als die Landeshauptfrau mit der FP zusammengegangen ist, bin ich ausgetreten. Ich war immer bekennende Großkoalitionärin, gerade im Gesundheitswesen darf es nicht um Parteipolitik gehen. Ich habe es großartig gefunden, dass im Burgenland über Parteigrenzen hinaus beschlossen wurde, dass Krebspatient*innen nicht im Krankenstand gekündigt werden dürfen.
Was ein Spital nicht leisten kann
Sie sollen das erste „Maggie’s Centre“ planen und leiten. Worum geht es?
Ich war vom Konzept von Maggie’s Centre sofort hingerissen (es kommt aus England, Anm.). Als Betroffene brauchst du schnell eine Diagnostik und eine gute Therapie, aber noch viele Dinge, die ein Spital überfordern würden. Anknüpfend an die Onkologie in Oberwart soll bis 2027 das erste Maggie’s Centre entstehen: ein Open Space, wo Betroffene und Angehörige hinkommen können, wo Raum etwa für Psycholog*innen, Ernährungsexpert*innen, Sozialarbeiter*innen und Selbsthilfegruppen sein soll.
Wir wollen auch mit der Österreichischen Krebshilfe Burgenland zusammenarbeiten, da wird es Gespräche geben. Mit Maggie’s Centre soll es demnächst in England zur Vertragsunterzeichnung kommen, wir sind dann die ersten Franchise-Nehmer in Österreich.
Wie achten Sie selber heute auf sich?
An der Klinik, wo ich die Chemotherapie kriege, habe ich immer wieder mit einer Psycho-Onkologin gesprochen; durch die Krankheit kommt alles durcheinander, da wird man auch leicht depressiv. Ich bin aktuell so nah am Wasser gebaut, dass ich heule, wenn ich einen angebundenen Hund vorm Billa sehe.
Lang habe ich Raubbau an meinem Körper betrieben und ihm befohlen, zu funktionieren.
Ich musste lernen, auf meinen Körper zu hören und Dinge, die er nicht schafft, nicht zu tun. Ich sage heute auch spannende Themen ab, am Wochenende drehe ich mein Handy ab. Ich habe zwar keine Familie, aber einen tollen Freundeskreis, der soziale Kontakt ist etwas ganz Wesentliches. Die schimpfen mit mir, wenn ich jetzt auch wieder mehr Interviews gebe. Aber: Ich kämpfe so lange um eine Reform des Gesundheitswesens, genau jetzt, wo es mir körperlich schlecht geht, öffnet sich ein Window of Opportunity.
Jahrzehnte lange Expertise
Werden Sie gehört, weil Sie betroffen sind?
Auch meine Expertise ist bekannt, dass ich alle Spektren des Gesundheitswesens kenne. Ich habe Spitäler leiten dürfen, ich bin Intensivmedizinerin, Anästhesistin und komme aus der Notfallmedizin. Ich war Gesundheitspolitikerin und in der Beratung bei PricewaterhouseCoopers; ich habe ebenso in Brüssel bei strategischen Entwicklungen beraten, ich kenne die Gesundheitssysteme fast aller europäischen Länder – und der letzte Punkt, auf den ich gerne verzichtet hätte, ist eben, dass ich alles als Betroffene sehe. Ich würde es nicht aushalten, nach 40 Jahren im Gesundheitswesen nichts zu sagen.



… weil Sie sehen, was schiefläuft?
Ich habe es schon vor 20 Jahren gesagt, es hat mir niemand zugehört. Da war noch mehr Geld da und da waren keine Toten. Unser Gesundheitssystem ist ein Notfall, um es zu retten, müsste die Politik endlich Mut zeigen. Die Vorarlberger haben entschieden, kleine Strukturen zu größeren zusammenzuführen. Je mehr Spitäler ich habe, desto weniger Fallzahlen habe ich pro Spital; aber Fallzahlen sind ein Qualitätskriterium, wir in der Medizin sind keine Künstler*innen, wir sind Handwerker*innen. Je öfter wir etwas machen und je öfter wir in Teams zusammenspielen, beispielsweise in Notfallteams oder im geburtshilflichen Bereich, umso besser funktioniert es.
Mit mehr Fallzahlen kann auch Forschung betrieben werden, das gilt auch für kleinere Strukturen, wie die Onkologie in Oberwart, die ausgezeichnet ist, weil es genug Fallzahlen gibt. Aber kein normal denkender Mensch würde ein Spital einfach schließen. Das ist eine der wertvollsten Immobilien. Man kann es für andere Gesundheitsvarianten verwenden: als Primärversorgungszentrum, Mutter-Kind-Ambulanzen, psychologische Ambulanz für Jugendliche …
Wir hatten eine Podiumsdiskussion dazu: Wir wünschen uns eine Menopausenambulanz.
Richtig, das wäre auch gut, ebenso eine für Männergesundheit. Wesentlich wäre, der Bevölkerung klarzumachen, sie hätte einen Vorteil und keinen Nachteil daraus. Das braucht eine gute Kommunikation; das sogenannte „Patient Empowerment“ ist unsere Aufgabe, also die Österreicher*innen auf ein Niveau zu heben, damit sie das Gesundheitssystem verstehen, um ein gleichwertiger Stakeholder zu sein.
Tipps zur Selbstfürsorge
Noch einmal zu Ihnen: Sie sprachen von „Raubbau am Körper“. Was bereuen Sie heute?
Ich habe immer viel gearbeitet; das mit dem Lebensstil ist so eine Sache, es geht ja auch um Genuss. Ein Gläschen Wein würde ich mir nicht verbieten lassen und ich freue mich jetzt schon auf ein Gansl nächstes Jahr im Burgenland, grad kann ich wegen der Chemo nicht daran denken. Was ich aus heutiger Sicht nicht mehr machen würde, ist rauchen.
Wir widmen uns in diesem Heft dem Thema Selbstfürsorge, was empfehlen Sie?
Lernen, Nein zu sagen, und auch die Stille zu genießen. Mir hilft das Meer: einfach nur stundenlang auf den Horizont schauen. Ich versuche, die Zeit nicht voranzutreiben, sondern die Dinge mit Leidenschaft zu tun, die ich jetzt gerade tue. Außerdem sind Schlaf und Atmen wichtige Dinge – und Freundschaften! Und an die Jungen: den Beruf wählen, den man mag. Ich finde meinen Beruf seit 40 Jahren sexy, daher treibe ich die Zeit nicht voran.
Maggie’s Centre
Geschichte kurz notiert

Das heute weltweit knapp 30 Zentren umfassende Netzwerk geht auf die Initiative der Gartenarchitektin und Autorin Maggie Keswick Jencks zurück. Sie erkrankte selbst an Krebs und gründete 1996 das erste „Maggie’s“ in Edinburgh. Die Einrichtungen verstehen sich nicht als Behandlungs-, sondern als Unterstützungsraum für Menschen mit onkologischen Erkrankungen und ihre Angehörigen. Ein Blick auf die Website lohnt sich: Ein verbindendes Merkmal der Zentren sind die freundliche, helle, teilweise auch farbenfrohe Architektur.
www.maggies.org
Weitere Artikel zu diesem Thema
Abo