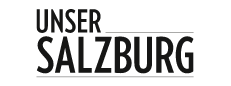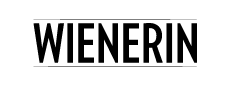© Shutterstock
Der Begriff “Kinkeeping” ist in Österreich noch recht unbekannt, aber im englischsprachigen Raum längst fester Bestandteil der soziologischen Diskussion. Kinkeeping beschreibt eine entscheidende soziale Funktion innerhalb von der Familienstrukturen und ist eine Aufgabe, die nach wie vor hauptsächlich von Frauen übernommen wird.
Das bedeutet Kinkeeping:
Solange ich denken kann, war meine Mutter für die verschiedenen Beziehungen innerhalb unserer Familie zuständig. Und auch heute kümmert sie sich darum, dass mein Vater seine Schwester anruft, die Enkelkinder, die faktisch nur mit meinem Vater verwandt sind, Geschenke zu den Geburtstagen und Feiertagen bekommen. Als wäre es etwas ganz Selbstverständliches. Und das, obwohl meine Eltern nicht unbedingt nach einer klassisch geprägten Rollenverteilung leben. Meine Mutter ist feministisch, engagiert sich im ZONTA Club für die Rechte von Frauen und Mädchen und ist relativ schnell nach meiner Geburt wieder Vollzeit arbeiten gegangen. Aber sie ist dennoch ganz selbstverständlich diejenige, die die Verwandtschaftsbeziehungen aufrecht hält. Wie die meisten Frauen.
Was oft als „liebevolle Hingabe“ bezeichnet wird, hat im Englischen den Namen “Kinkeeping”. Die deutsche Übersetzung klingt etwas sperrig, aber ist doch treffend: “Wächterin der Verwandtschaft”. Frauen leisten die organisatorische und emotionale Arbeit, die nötig ist, um den familiären Zusammenhalt aufrechtzuerhalten.
Diese Aufgaben fallen in den Bereich Kinkeeping:
Kinkeeping scheint unsichtbar zu sein, ein unsichtbarer Klebstoff sozusagen, der die Familie zusammenhält. Nur dass es kein unsichtbarer Klebstoff ist, sondern in den meisten Fällen die Frauen der Familie. Diese Aufgaben fallen unter anderem in den Bereich:
- Das Planen von Familientreffen und Feiern
- Der regelmäßige Kontakt zu Verwandten
- Das erinnern an Geburtstage und Jubiläen
- Die emotionale Unterstützung von Familienmitgliedern
- Die Pflege älterer Angehörige
- Die Vermittlung bei familiären Konflikten
Warum Kinkeeping so wichtig ist:
Ebenso wie Haushaltsarbeit wird Kinkeeping nicht bezahlt und geschieht im Verborgenen. Es hat jedoch eine enorme gesellschaftliche Bedeutung. Studien zeigen, dass stabile familiäre Netzwerke maßgeblich zur psychischen Gesundheit und zum sozialen Wohlbefinden beitragen. Durch Kinkeeping werden Informationen innerhalb der Familie weitergegeben, emotionale Bindungen gestärkt und familiäre Werte bewahrt. Kurz gesagt: Ohne Kinkeeping droht der Zerfall des familiären Zusammenhalts – vor allem in unserer zunehmend individualisierten Gesellschaft.
Warum übernehmen vor allem Frauen diese Rolle?

Die Rolle der Frau als diejenige, die alle organisiert, hat tiefe historische und kulturelle Wurzeln. Schon immer waren es überwiegend Mütter, Töchter, Ehefrauen oder Schwestern, die die emotionale Verantwortung in der Familie getragen haben. Auch heute zeigen soziologische Untersuchungen, dass Frauen signifikant häufiger als Männer Kinkeeping-Aufgaben übernehmen.
Mögliche Gründe dafür:
- Sozialisierung: Frauen werden meistens schon in der Kindheit darauf vorbereitet, sich um andere zu kümmern.
- Gesellschaftliche Erwartung: Das traditionelle Bild der Frau als „Kümmerin“ wirkt weiterhin stark.
- Fehlende Anerkennung: Da Kinkeeping selten als Arbeit anerkannt wird, wird es automatisch der Frau zugeschrieben – zusätzlich zu Beruf, Haushalt und Kindererziehung.
Zeit für mehr Anerkennung und Gleichverteilung
Kinkeeping ist ein zentraler Bestandteil von Fürsorgearbeit und verdient mehr gesellschaftliche Anerkennung. Gleichzeitig sollte es nicht mehr nur als weibliche Aufgabe verstanden werden. Auch Männer sollten Verantwortung für familiäre Beziehungen übernehmen.
Was wir dafür brauchen:
- Mehr Sichtbarkeit für emotionale Arbeit
- Aufwertung von Care-Arbeit – auch in politischen Debatten
- Förderung partnerschaftlicher Rollenverteilungen
Das könnte dich auch interessieren:
Wie die Popkultur der 2000er Frauen gegeneinander aufbrachte
„Wie geht’s?“: Wie damit vermeintlich simpler Smalltalk Deep wird
Toxische Beziehung: So erkennst du die Anzeichen
Über die Autorin dieses Beitrags:

Lara Amhofer ist für die Social-Media-Kanäle der STEIRERIN zuständig und betreut das Ressort Online. Sie schreibt über Trends in jeglichen Bereichen und probiert diese auch gern mal selbst aus. Ihr Herz schlägt für Katzen und Taylor Swift Songs. Sie liebt es gute Bücher mit einer Tasse Kaffee in der Sonne zu lesen.
Weitere Artikel zu diesem Thema
Lifestyle
5 Min.
Reisetipps ab Österreich: 2026 wird bewusst & entspannt
Slow Travel, Naturerlebnisse, Social-Media-Hotspots und gut erreichbare Destinationen
Reisen ist längst mehr als Ortswechsel – es ist Ausdruck von Lebensstil, Haltung und Zeitgeist. Während Social Media unsere Sehnsuchtsorte schneller denn je sichtbar macht, wächst gleichzeitig das Bedürfnis nach echten Erlebnissen, Ruhe und Bedeutung. 2026 wird das Reisejahr für alle, die bewusster, aber nicht weniger inspirierend unterwegs sein wollen. Slow Travel & Deep Experience: … Continued
5 Min.
Mehr zu Lifestyle

Abo