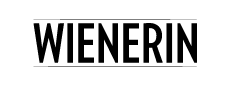Doris Schamp verlor ihr Embryo und fast ihr eigenes Leben
Fehlgeburt: Als die Reise zu Ende ging.
© Vanessa Hartmann
Wenn du die Grippe hattest, fragen dich die Leute: Wie geht es dir? War’s schlimm? – Wenn du eine Fehlgeburt hattest, sehen dir viele nicht einmal in die Augen“, sagt Doris Schamp. Es war ein Wunschkind, das die Künstlerin aus Oberpullendorf unter ihrem Herzen trug. Sie erlebte die Vorfreude mit ihrem Partner, das Hormonchaos, die Sorgen und Überlegungen im Vorfeld, wie Berufsalltag mit Baby zu vereinen wäre, die Namenssuche – und dann den tiefen Fall, als plötzlich alles vorbei war.
Doris Schamp kommt aus einer Mediziner*innen-Familie, auch ihr Mann ist Arzt. Dass Fehlgeburten passieren, weiß sie. Auch dass Trauer Platz braucht. Was sie nicht geahnt hatte, ist, dass sie nach ihrem Schicksalsschlag mit lähmendem Schweigen und dem Alleingelassensein konfrontiert wird. „Es gibt Rituale für Geburtstage, Hochzeiten, Todesfälle, aber für eine Fehlgeburt gibt es in unserer Kultur kein Ritual“, bedauert sie. Dabei betrifft ein Schwangerschaftsverlust etwa jede zweite bis sechste Frau mindestens einmal im Leben.
In ihr pulsiert viel kreative Energie, ihre oftmals pointiert kritischen Arbeiten finden auch international Anerkennung. Der Schmerz, die Frustration und die Wut wollen künstlerisch aus ihr heraus – und zwar mit dem ersten Joghurtbecher, in dem Doris Schamp ihr eigenes Blut auffängt und auf eine Leinwand schüttet.
Gänsehaut? „Nitsch verwendete Tierblut und ich habe mich nicht einmal getraut, mein eigenes Blutbild in meiner Ausstellung zu zeigen, weil unsere Hemmschwelle bei Fehlgeburten so groß ist. Wir werden so sozialisiert. Dabei ist mein Blutbild ein wirklich gutes Bild“, sagt sie. Der BURGENLÄNDERIN stellt sie diese Arbeit erstmals zum Abdruck zur Verfügung.
Die Fehlgeburt
Es fing mit einer Mutter-Kind-Pass-Untersuchung an. „Das gefällt mir gar nicht“, sagte die Gynäkologin plötzlich. Kein Herzschlag. Im nächsten Moment zog sie den Mutter-Kind-Pass vom Tisch, „den kriegen Sie heute nicht“.
Drei bis sechs Wochen würde es dauern, bis eine Blutung kommt, bekam sie noch als Information mit, und dass sie dann möglichst nicht allein zu Hause sein sollte. Wie soll das im Berufsalltag gehen? „Die Reise war zu Ende. Von einem Moment auf den anderen.“
Während einer eleganten Abendveranstaltung fängt sie zu bluten an. „Du siehst die rote Lache am WC und fragst dich: War es das? – Dann hältst du kurz inne, drückst die Spülung, wäschst dir die Hände, gehst wieder raus in die Hihi-Haha-Gesellschaft. Und du verlierst natürlich kein Wort darüber, denn damit kann man doch niemanden konfrontieren“, erinnert sie sich.



Am nächsten Morgen blutet sie noch immer, irgendwann am Vormittag ist der Vorrat an Binden aufgebraucht und sie lässt das Blut in einen Becher tropfen. „Da muss man ein bisschen die Zähne zusammenbeißen“, hört sie am Telefon, als sie um Rat fragt. Wie viel ist „normal“, wie viel muss sie „einfach aushalten“, fragt sie sich.
Am frühen Nachmittag hat sie keine Kraft mehr, aufrecht zu stehen, sie ruft die Rettung. „Wie viel Blut haben Sie verloren?“, fragt der Sanitäter. „Ich habe es nicht gemessen.“ – „Sie wissen aber schon, dass Sie nur fünf Liter haben?“
Im Spital wird beraten, auf welche Station sie kommen soll. Ist sie nun noch schwanger oder nicht? Es gibt zu wenig Betten, sie wird auf die Onkologie gebracht, zwei Brustkrebspatientinnen tragen sie mit „Totengräberhumor“ ganz nach ihrem Geschmack, wie sie sagt, durch Stunden, die ihre letzten hätten sein können.
„Mein Hämoglobinwert war bereits kritisch“, sagt Doris Schamp. Als irgendwann in der Nacht alle notwendigen Tests abgeschlossen waren, bekommt sie die lebensrettenden Blutkonserven. Dazwischen liegen Stunden mit Herzrasen, Fieber, Panikzuständen – und einer Nahtoderfahrung, „die sehr erkenntnisreich war“, erzählt sie. „Ich bin nicht religiös, aber es war, als hätte mir jemand erklärt, dass es das Ziel meines Lebens ist, glücklich zu sein und das Glück weiterzugeben. Das Ziel der Menschheit sei es, sich fortzupflanzen, aber ob ich ein Kind kriege, spiele keine Rolle.“
Die Schuldfrage
Grund für ihre starke Blutung waren Gewebeteile, die sich nicht gelöst hatten und wodurch sich die Gebärmutter nicht wieder zusammengezogen hatte.
Die Anämie schwächt sie enorm, es dauert Wochen, bis sie wieder zu Kräften kommt. Während sie innerlich noch dabei ist, ihre Traumata zu verarbeiten, „haben mich die Reaktionen in meinem Umfeld völlig vor den Kopf gestoßen“, beschreibt sie. Die einen schwiegen, fragten kein Wort, die anderen taten so, „als wäre eine Vase runtergefallen, dann kaufst du dir halt eine neue“.
„Uns Frauen werden von der Gesellschaft dauernd Regeln auferlegt: Wenn du schwanger bist, darfst du bis zum vierten Monat niemandem davon erzählen und dich nur im Stillen freuen. Eine Zeit lang kam ich mir dann nicht wie die Doris, sondern wie eine Gebärmaschine vor, die Dinge so tun soll, wie sie eben gemacht werden“, ärgert sich die Künstlerin. „Dann passierte mir die Fehlgeburt, und ich hatte ein solches Bedürfnis zu reden und sehnte mich nach Anteilnahme, nur dass man fragt: Wie geht es dir? Es tut mir leid, brauchst du etwas? – Aber das Thema wird vielfach totgeschwiegen. Der Embryo wurde noch eher bedauert als ich, die bei der Fehlgeburt fast draufgegangen wäre.“



Es ist „ein großer Brocken“, den man nach einem Schwangerschaftsverlust als Paar zu schlucken hat, sagt sie, aber es hilft sehr, über die eigenen Gefühle zu sprechen. „Anfangs habe ich mir noch die Frage gestellt, ob diese eine Skitour vielleicht … Aber mein Mann, der Arzt ist, hat mir sofort die Schuldgefühle genommen. Die Sache mit der Überbelastung ist schon zum Großteil ein Ammenmärchen, das man Frauen gerne umhängt, wenn eine Fehlgeburt passiert. Der männliche Samen hingegen gilt als ,heilig‘ in unserer patriarchalen Welt. Es sagt praktisch niemand bei einer Fehlgeburt als Erstes: ,Na ja, das wird am ungesunden Lebenswandel des Mannes liegen, da wird was mit den Samenzellen nicht gestimmt haben.‘ – Bis heute wird die Schuld erst bei der Frau gesucht und auch als Frau sucht man diese fatalerweise in erster Linie bei sich selbst.“
Was darf sie sagen?
Als sie in die Schule zurückkehrt, an der sie unterrichtet, möchten ihre Schüler*innen wissen, ob sie krank war. Was soll sie antworten? „Ich habe ihnen gesagt, dass ich eine Fehlgeburt hatte – und sie fingen selber zu erzählen an: von einer Tante, die eine Fehlgeburt hatte, vom Bruder, der eine Totgeburt war … Sie tauschten sofort Erfahrungen aus, da siehst du, dass es permanent überall passiert und dass das Reden fehlt. Trotzdem hatte ich immer im Hinterkopf, ob mir am nächsten Tag ihre Eltern womöglich vorwerfen: Wieso erzählen Sie unseren Kindern von Ihrer Fehlgeburt?“
So geht es Doris Schamp immer wieder, wenn sie sich öffnet: Junge und alte Frauen beginnen zu reden, sie hört und liest viele bewegende Geschichten. Sie beschließt, ihre Ausstellung „Existence“ dem Thema Fehlgeburt und dem Lebensprozess zu widmen; in der Mattersburger Artbox wird ihr dafür über den vergangenen Sommer Raum gegeben. Darin zeigt sie Arbeiten wie die Sternenmutter, eine Skulptur, über der Embryos aus Zinn hängen, ihr „Milchtagebuch/Dairy Diary“, eine „angefressen dreinschauende“ Jizo-Figur aus Ton – in Japan werden sie als Begleiter toter Kinder aufgestellt. Und sie präsentiert ein auf Wienerisch verfasstes Gedicht.
„A Gynäkologin so trockn wie a Grissini, hats aussegfischt die Tortellini“, lautet eine Textzeile daraus.
„Und so sehr ich den Drang verspürt habe, dieses scheinbar einzementierte Tabu zu brechen und Frauen mit derselben Erfahrung Mut zu machen, habe ich am Vorabend sehr gezweifelt und gehadert, ob ich zum Beispiel das Fehlgeburtstags-Gedicht ausstellen soll.“
Die Eröffnungsrede hält die Kunsthistorikerin und Kulturwissenschaftlerin Marija Nujic, die schwer beeindruckt ist: „Das Frau-Sein benötigt Frauen, um zu überleben. Frauen brauchen jene von uns, die in jeglicher Form Frau sind und Frauenerfahrungen gemacht haben, um zu überleben. Das Frau-Sein lebt und überlebt durch euch und ganz besonders durch dich, liebe Doris. Vielen Dank für deinen Mut.“
„Doris, das ist gesellschaftsbewegend, so etwas gab es noch nicht“, sagte sie nach ihrer Rede zur Künstlerin, und um sie entstand eine kleine Runde an Leidensgenossinnen, die ins Sprechen kamen. Eine 70-Jährige erzählte von ihrer Fehlgeburt und dass sie jahrelang kein Wort darüber verlor. Marija Nujic wurde quasi Doris Schamps Projektpartnerin, um die Ausstellung nach Wien zu bringen. Dafür stehen aktuell die Zeichen sehr gut, die Werke sind bereits in einer engen Auswahl für eine prominente Präsentationsmöglichkeit.
„Ich habe meine Fehlgeburt und den Frust mit der Gesellschaft mit Kunst verarbeitet. Auch mit Humor kannst du die schrecklichsten Themen an die Leute heranbringen, sodass sie ins Reden kommen. Das Totschweigen der anderen ist das Schlimmste, wenn man betroffen ist. Natürlich will ich primär Frauen Mut machen, damit sie dann sagen können: Die traut sich, eine Ausstellung darüber zu machen, und redet öffentlich über ihre Fehlgeburt, dann traue ich mich auch, vorm vierten Monat zu sagen, dass ich schwanger bin, egal was die Gesellschaft von mir erwartet.“
HIER ein weiterer Beitrag zu Doris Schamp
Weitere Artikel zu diesem Thema
Abo