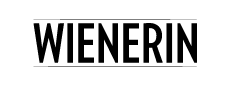Stefanie Sargnagel © Vanessa Hartmann
Ich habe keine statistische Erhebung gemacht, aber ich habe viele Männer im Literaturhaus Mattersburg gesehen. Nicht nur junge bärtige Hipstermänner, sondern aus allen Generationen. Und ich habe sie aufmerksam zuhören und lachen gesehen. Gut, Stefanie Sargnagel hat dort kein männerfeindliches Pamphlet vorgetragen, aber immerhin aus ihrem aktuellen Buch „Iowa. Ein Ausflug nach Amerika“ (Rowohlt) gelesen, dessen Hauptprotagonist*innen gestandene Feministinnen sind: die Autorin selbst, die legendäre Musikerin Christiane Rösinger – sie ist Mitbegründerin der „Lassie Singers“ – sowie Stefanie Sargnagels Mama. Sonst reicht manchmal nämlich schon das Wort Feminismus, um Männer in die Flucht zu schlagen.
Stefanie Sargnagels Lese-Termine: fast ausnahmslos ausverkauft
Die bis dahin veröffentlichten Lese-Termine von Stefanie Sargnagel waren fast ausnahmslos ausverkauft, Mattersburg war quasi ein Geheimtipp, wo man noch relativ kurzfristig einen Platz ergattern konnte, ehe es voll wurde; das zog auch Gäst*innen aus Wien an.
In der ersten Reihe saß die Mama der Künstlerin und amüsierte sich mit uns allen prächtig. Die Tochter war 2022 eingeladen worden, um Creative Writing am College der Kleinstadt Grinnell zu unterrichten; „Iowa“ entstand während und nach dieser Reise in die USA. Stefanie Sargnagels scharfsinnige Beobachtungen, ihr trockener Humor und ihre Selbstironie sind ein Genuss, ihre Lesung war so unterhaltsam wie ein Kabarett. Geplaudert haben wir direkt davor.

Viktória Kery-Erdélyi: Wozu brauchen wir den Feminismus?
Stefanie Sargnagel: Manche brauchen ihn eh nicht. Aber als Frau hat es natürlich viele Vorteile. Man ist halt benachteiligt ohne feministische Bewegungen, hat schlechtere Rechte und Chancen – das ist ganz simpel.
Ich habe zwei Töchter, was soll ich den beiden mitgeben?
Ich weiß nicht, ich habe keine Kinder. (Stefanie lacht und dann sagt sie doch etwas dazu.) Ich habe auch lange geglaubt, ich brauche den Feminismus nicht. Als ich jung war, dachte ich, ich kann eh machen, was ich will. Ich war an Schulen, wo Burschen unterrepräsentiert waren, ich bin quasi ohne Vater und mit relativ wenig Männern in der Familie aufgewachsen, ich habe immer das Gefühl gehabt, Frauen sind sowieso die Dominierenden.
Es hätte mir aber viel gebracht, wenn ich schon früher feministische Texte gelesen hätte. Ich bin hetero; grad was Beziehungen angeht, hätte ich mir da weniger gefallen lassen. Freundinnen, die schon mit 14, 15 in feministischen Gruppen waren, haben nicht die Fehler gemacht wie ich, sie haben früher Grenzen gesetzt oder ein besseres Verhältnis zu ihrem Körper gehabt, weil sie sich mehr damit auseinandergesetzt haben, wie sie sich selbst besser behaupten können. Viele Probleme werden erst offensichtlich, wenn man ins Erwachsenenleben eintritt oder wenn die Leute Kinder kriegen.

„Iowa“ ist ein Dialog auf mehreren Ebenen. Du beschreibst Gespräche und Christiane Rösinger kommentiert direkt in pointierten Fußnoten. Du erzählst beispielsweise von der Tristesse ihrer Zimmerpflanzen, sie stellt dein botanisches Urteilsvermögen infrage. Das ist köstlich und schön, wie viel Offenheit und Ehrlichkeit zwischen euch möglich ist. Sind Frauenfreundschaften speziell?
Tatsächlich merke ich, wie ich gegenüber Männern intoleranter werde. Ich bin immer gern viel mit Männern abgehangen, das fällt mir mittlerweile schwerer, weil ich Männer viel zu kritisch sehe. Das finde ich aber auch wieder gut. Wenn ich manchmal geschlechtsspezifisches Dominanzverhalten bei meinen Freunden sehe, denke ich mir, wenn ich die jetzt nicht so lange schon kennen würde, würde ich mich gar nicht mit denen anfreunden.
Man unterschätzt, wie gut es manchmal tut, wenn man mal wenig mit Männern zu tun hat. Ich merke, wie lustig Gruppenurlaube mit Freundinnen sind oder wie sehr mich die Burschenschaft (sie meint den feministischen Geheimbund „Hysteria“, Anm.) gestärkt hat. Ich will jetzt auch nicht so verallgemeinern, Männer sind auch komplex und unterschiedlich, ich will sie nicht auf ihr Geschlecht reduzieren.
Ich habe auch sehr gute langjährige Freunde, die eher konservativ ticken. Wie begegnest du solchen Männern?
Wenn ich mit Verallgemeinerungen komme, geraten Männer in eine Abwehrhaltung, sie fühlen sich persönlich angegriffen; ich verstehe das auch, das ist menschlich. Ich mag gerne Humor; man kann vieles lösen, indem man ein bisschen stichelt. Das ist mehr meine Art, als eine Grundsatzdiskussion anzufangen. Wobei ich schon eher sagen würde, dass meine Generation an Freunden eigentlich feministisch ist; ich bin in einem Milieu aufgewachsen, in dem dieser klassische Machismus gar nicht mehr so arg existiert.
Rollenbilder an sich wären kein Problem, wenn sie gleichwertig wären.
Stefanie Sargnagel
Nach Missbrauchsvorwürfen gegen Mitglieder einer Band bist du im vergangenen Sommer auf die Straße gegangen, um gegen deren Konzerte zu demonstrieren – warum?
Um zu zeigen: Es gibt Leute auf der Seite der Opfer. So viele kennen es, dass man ihnen nicht glaubt. Alle erkennen zwar an, dass es Gewalt in der Familie von Männern gibt, dass es Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch gibt. Sobald das jemand im Nahverhältnis ist oder jemand, den man mag, will man sich damit nicht beschäftigen. Menschen sind nicht schwarz-weiß. Jemand kann sympathisch sein und trotzdem ganz andere Seiten in einer Beziehung haben. Menschen sind nicht gut oder böse, sondern widersprüchliche Wesen.
Man hat den Groupies, die Übergriffe erlitten haben, abgesprochen, dass sie das erlebt hätten. Ich bin auf die Straße, um generell zu zeigen: Es gibt eine Gruppe von Leuten, die glauben Missbrauchsopfern. Ich hatte selbst nach einem Übergriff Verletzungen an den Händen und der Arzt hat mich tatsächlich gefragt, ob ich mir sicher bin, dass es ein Übergriff war – und das obwohl meine Verletzungen eindeutig gezeigt haben, dass ich mich gewehrt habe.
Deine Zeichnungen und Texte sind pointiert, kritisch und sehr präzise. Du wirkst furchtlos – bist du das?
Ich würde nicht sagen, dass ich furchtlos bin, ich habe manchmal eine latente Sozialphobie, nicht schlimm. Mich stört Öffentlichkeit nicht. Ich habe nicht so Angst, angegriffen zu werden, und ein gewisses Grundvertrauen in die Menschen, das vielleicht manchmal nicht so realistisch ist. Öffentlichkeit kann auch ein bisschen Schutz sein, wenn man eine Stimme und viel Reichweite hat.
Das sieht man jetzt bei den Nazis: Die waren früher im Keller und anonym und haben geschaut, dass nie Fotos von ihnen in der Öffentlichkeit sind. Sie haben aber gelernt, dass es einen gewissen Schutz gibt, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie dadurch alles aus ihrer Perspektive erzählen können.

Hast du die Hoffnung, etwas bewirken zu können – oder muss „es“ vorrangig aus dir raus?
Ich habe ein kreatives Ausdrucksbedürfnis, das ich auch nicht besonders einschränken könnte. Und ich habe auch das Bedürfnis – das liegt an meinem Idealismus –, Leute zu motivieren, sich weniger zu scheißen, sich gegen Sachen zu stellen und sich ihre eigenen Gedanken zu machen.
Ich picke eine meiner vielen Lieblingsstellen heraus: eine Ode ans weibliche Tratschen. Worum geht es dir da?
Es ist einfach so, dass weibliche Hobbys und Interessen ein bisschen abgewertet werden und nie so cool und romantisiert sind wie männliche – wie zum Beispiel das Fischen, das auch nicht sinnvoller oder sinnloser ist als Stricken.
Eine Verallgemeinerung, die ich auch im Umfeld beobachte: Männer unterhalten sich stark über Sachthemen, bei den Frauen geht es vielmehr darum, wie es einander geht und was alles passiert. Das ist manchmal echt witzig: Ein Freund trifft den anderen und du fragst danach, wie es dem anderen geht, weil er kürzlich eine Trennung hatte. Die Antwort ist dann: „Aso, naaa, darüber haben wir nicht geredet.“
Wenn es heißt, Frauen sind Tratschen – und ich meine nicht, über Leute herzuziehen –, dann ist das eine Abwertung. Dabei ist es doch sinnvoller, dass man darüber redet, wie es einander geht, und sich ein bisschen über das Soziale updatet, als wenn man nicht einmal weiß, wie es einem Freund nach einer Trennung geht. Ich finde es manchmal gar nicht schlimm, dass es Frauen- und Männerklischees gibt. Schlimm ist, dass Frauenklischees abgewertet werden. Rollenbilder an sich wären ja kein Problem, wenn sie gleichwertig wären.

Zur Person Stefanie Sargnagel
… wuchs in Wien als Tochter einer alleinerziehenden Krankenschwester auf und studierte eine Zeit lang an der Akademie der bildenden Künste Malerei bei Daniel Richter. Parallel arbeitete sie im Callcenter und schrieb ihr erstes Buch „Binge Living: Callcenter-Monologe“ (redelsteiner dahimène edition). 2016 wurde sie mit dem BKS-Bank-Publikumspreis beim Wettbewerb zum Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet. Ihre Bücher „Statusmeldungen“ und „Dicht“ (Rowohlt) wurden Bestseller. Stefanie Sargnagel ist zudem eine geniale Cartoonistin, am besten folgt man ihr via Instagram @sargnagelstefe.
Lesungen: www.stefaniesargnagel.at
Weitere Artikel zu diesem Thema
Abo