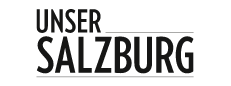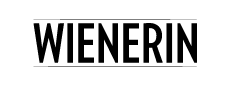Jaqueline Scheiber: Das Gespräch zum Romandebüt
Jaqueline Scheiber richtet in „dreimeterdreißig“ den Blick auf Dinge, die vor uns passieren, die wir aber oft nicht sehen.
Jaqueline Scheiber © Sophie Nawratil
Jaqueline Scheiber richtet in „dreimeterdreißig“ den Blick auf Dinge, die vor uns passieren, die wir aber oft nicht sehen: etwa auf den Moment nach dem Tod oder auf Lebensrealitäten, die uns nur scheinbar vertraut sind.
Sie trug eine blitzblaue Strumpfhose und einen opulenten Traum aus rosa Rüschen, die Farben ihres Buchcovers. Es konnte nicht extravagant genug sein – für den Tag, „auf den ich unübertrieben seit Jahren hingefiebert habe“, sagt Jaqueline Scheiber.
Aufgewachsen im Bezirk Mattersburg, schreibt sie, seit sie 16 Jahre alt ist. Tatsächlich veröffentlichte sie bereits mehrere Bücher, darunter „Offenheit“, (autobiografische) Reflexionen über Sein und Tun in der virtuellen Welt (Kremayr & Scheriau). Doch „dreimeterdreißig“ ist ihr lang ersehntes Romandebüt, ihre Präsentation in Wien wird „einer der schönsten Tage, die ich je erleben durfte“.
In ihrem Buch beschreibt sie das Schönste und das Schmerzvollste. Eines Nachts wacht Klara neben dem reglosen Körper von Balázs auf. Hinter ihnen liegt die Zeit des Zusammenfindens, was vor ihr liegt, weiß Klara noch nicht.
Die Autorin richtet die Lupe auf einen zeitlich winzigen Lebensausschnitt, die Wucht dieses unumkehrbaren Moments kann sie umso mehr entfalten, weil sie präzise und gleichsam behutsam in die Biografien ihrer Figuren taucht.
Weil sie sich dafür interessiert, woher sie kommen, warum sie sind, wie sie sind, und vor allem, warum sie so denken und handeln, wie sie es tun. Was Jaqueline Scheiber da in ihrer besonderen Sprache komponierte, ist berührend, fesselnd und poetisch.
HIER geht’s zum Video!
Du betonst, dass es nicht autobiografisch ist, aber du schöpfst aus persönlichen Erfahrungen …
Jaqueline Scheiber: Ich habe in meinen Zwanzigern innerhalb von zwei Jahren zwei sehr nahe Todesfälle erlebt, von meinem Freund und meiner längsten Freundin. Ich habe mich sehr tief mit meiner Trauer auseinandergesetzt. 2017 habe ich auch den „Young Widow_ers Dinner Club“ mitbegründet und dabei sehr viele Einblicke bekommen. Ich bin mit meiner Geschichte sehr bewusst und öffentlich umgegangen, ich habe mich aber die letzten Jahre hier zurückgenommen.
In meinem Roman bewege ich mich in einem Gebiet, das ich gut kenne. Mir ging es aber nicht um die Verarbeitung von Trauer, sondern um das „Nicht-Wahrhaben-Wollen“. Mich interessierte: Was passiert in diesem Moment dazwischen?
Es geht auch um Liebe. Der Stellenwert von Paarbeziehungen wird heute durchaus infrage gestellt, wie stehst du dazu?
Ich fand es schön, eine pathetische Liebesgeschichte zu erzählen, wir brauchen positive Beispiele. Aber ich zeige auch Freund*innenschaft und Geschwisterbeziehung. Ich zeige, dass es viele Arten von Liebe gibt, die ineinandergreifen und einen hohen Stellenwert haben. Man sollte nicht nach der einen Beziehung jagen, man kann unterschiedliche Formen leben.
Spannend finde ich nicht nur Balázs’ ungarischen Background, sondern dass ihn aus politischer Korrektheit niemand danach fragt. Er würde es sich aber eigentlich wünschen …

Mir ging es nicht um die Verarbeitung von Trauer, sondern
Jaqueline Scheiber, Autorin
um das „Nicht-Wahrhaben-Wollen“.
Auch meine ungarische Herkunft ist praktisch nie ein Thema, weil ich keinen sichtbaren Migrationshintergrund habe. Das heißt aber auch, dass diese Identität keine Sichtbarkeit hat. Ich habe für das Buch Interviews mit jungen Auslandsungar*innen geführt. Viele fliegen wie ich sozusagen ein bisschen unterm Radar, weil Ungarn nahe ist, weil sie Deutsch sprechen.
Was mich außerdem extrem interessiert hat, war, wie es der Generation geht, die um die Wende (1989, Anm.) geboren wurde. Diese Menschen wuchsen in einem politisch instabilen Land auf, das etwa 15 Jahre später wieder in eine Form von Autokratie kippte. Heute kämpfen sie mit ihren Zukunftsideen. Ich wollte, dass meine Figur sie sozusagen nebenbei nahebringt.
Apropos politische Korrektheit: Was „darf“ man fragen?
Ich glaube, die Intention und der Kontext spielen eine große Rolle. Wenn ich zu einem Tisch mit Menschen, die ich nicht kenne, dazukomme und die erste Frage, die ich einer Person stelle, die womöglich nicht weiß ist und autochthon ausschaut, ist, woher sie kommt, dann ist die Intention nicht richtig. Das hat einen Unterton von „die kann ja nicht da hergehören“. In einem guten Gespräch kann ich aus ehrlichem Interesse aber durchaus fragen, es kommt auch auf die Beziehung an.
Man darf die Diskussion über Sprache und bewusste Reflexion über politische Prozesse nicht damit verwechseln, dass man keine Fragen mehr stellen darf. Es ist beides nicht gut: das Vorpreschen und das Auf-Eierschalen-Gehen.
Du beschreibst mit sehr viel Feingefühl etwa die prekäre Kindheit, die Balázs erlebte. Ist das auf eigene Erfahrungen oder auf die als Sozialarbeiterin zurückzuführen?
Ich glaube, es ist ein Schmelzpunkt aus beidem. Ich habe bei der Wiener Kinder- und Jugendhilfe viele Familien betreut, wo es an vielen Ecken gefehlt hat, wo auch Gewalt und Vernachlässigung entstanden. Andere Sinneseindrücke sind wiederum welche, an die ich mich selber erinnere.
Es ist mir im Gedächtnis geblieben, wie meine Mutter sich darum bemüht hat, dass ich nicht zur Außenseiterin werde, aber man gleichzeitig nach dem ersten Waschen sehen konnte, dass ich kein echtes Adidas-Leiberl trage. Ich habe aber entschieden, dass Balázs durch seine Erfahrungen nicht härter wird, sondern dass ihn das auf eine Art weicher macht.
Ich wollte damit nicht sagen, dass jede*r seine Herkunft überwinden muss, für ihn ist das sehr zentral, dass er das integrieren kann.
Vermisst du es, Sozialarbeiterin zu sein?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe während meinem Studium schon im zweiten Semester in der Suchthilfe angefangen. Ich würde noch immer in der sozialen Arbeit sein, wenn das irgendwie vereinbar wäre. Aber das geht nicht, wenn man versucht, auch mit dem Schreiben Raum einzunehmen.

Sozialarbeit ist der Beruf, der am meisten Sinn ergibt. Ich vermisse es manchmal.
Jaqueline Scheiber, Autorin
Es ist auf jeden Fall der Beruf, der am meisten Sinn ergibt. Ich vermisse manchmal die Bodenhaftung, weil es in der Kultur- und Medienwelt so oft um Sachen geht, die fernab von dem sind, was den Großteil der Gesellschaft beschäftigt. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin zu wenig damit in Verbindung, und ich treffe sehr, sehr gerne meine Ex-Arbeitskolleg*innen, um mit ihnen darüber zu reden.
Wie hat dich diese Arbeit geprägt?
Sie hat mir beigebracht, dass Menschen Expert*innen für ihre Lebensrealitäten sind. Ich habe nie gesagt, ich bin die Professionistin und zeige dir, wie es geht, sondern: Ich will verstehen, wie du in diese Situation gekommen bist, und schauen, auf welchem Weg ich dich begleiten kann. Diese Haltung gegenüber Menschen, die vielleicht nicht mit Glück und positiven Fügungen gesegnet sind, ist eine ehrliche und sanfte Haltung und ich bin dankbar, dass ich das lernen musste.
Du hast mehr als 43.000 Follower auf Instagram. Ärgert es dich als Autorin, dass das auch ein Kriterium ist?
Ich habe 2024 bewusst mein Pseudonym „minusgold“ abgelegt, mit dem Roman wollte ich einen Cut machen und zeigen: Mein Job ist es nun wirklich, Literatur zu machen. Da hat es mich dann anfangs irritiert, dass in den Pressetexten wieder die Follower*innen angeführt wurden.
Aber ich durfte von meiner Freundin, die Buchhändlerin ist, lernen, dass das eben wichtig ist. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich aufgrund der Social-Media-Präsenz vom Literaturbetrieb nicht ernst genommen werde, auf der anderen Seite habe ich auch dort eine Leser*innenschaft, weil ich viel Arbeit hineingesteckt habe. Das ist ein zweischneidiges Schwert und ich würde mir auch abseits davon mehr Sichtbarkeit für viele Autor*innen und Debütant*innen wünschen.
Es passiert viel Schlimmes in der Welt und man hat manchmal das Gefühl, Social Media befeuert Distanzen und Gräben. Wie geht es dir damit?
Ich höre gerne den „Alles gesagt“-Podcast von Die Zeit. Das sind Gespräche mit unterschiedlichen Persönlichkeiten aus allen möglichen Bereichen. Sie gehen jeweils so lange, bis die interviewte Person sagt: Es ist alles gesagt. Das können sogar sechs- oder siebenstündige Gespräche sein.
Gerade wenn so viele Hiobsbotschaften daherkommen, beruhigt es mich total, Gedanken so lange folgen zu können, Menschen lange zuzuhören, die teilweise eine andere Meinung haben als ich. Selbst wenn ich manchmal laut aufschreien könnte, höre ich es mir an.
Ich habe gemerkt, wie viel das in mir verändert. Dass es entweder dazu führt, dass sich Meinungen verstärken, oder dass ich mich auch in meinem Spektrum bewege.
Wir müssen uns immer bewusst machen, dass Social Media verkürzte Informationen zu komplexen Themen bietet, die mehr Zeit und Aufmerksamkeit brauchen. Mein Credo bleibt: Wir können Social Media trotzdem für positive Effekte nutzen, für Organisationen, Aufrufe und Diversität. Ich würde mir wünschen, dass wir dort das verstärken, was wir verstärken können: Solidarität und Empathie.
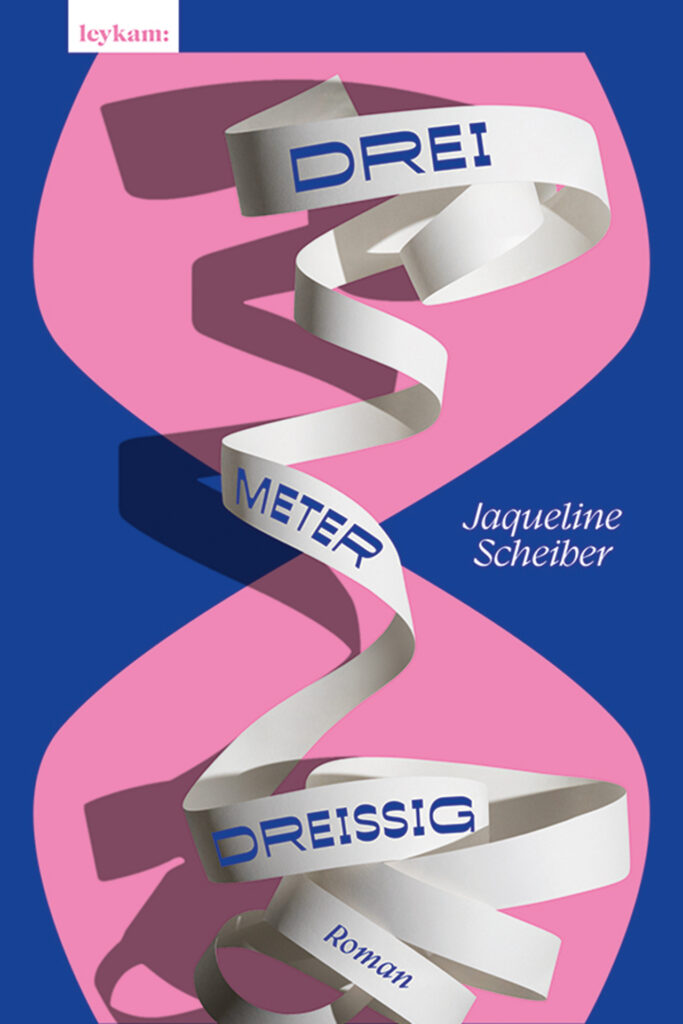
Weitere Artikel zu diesem Thema
Abo